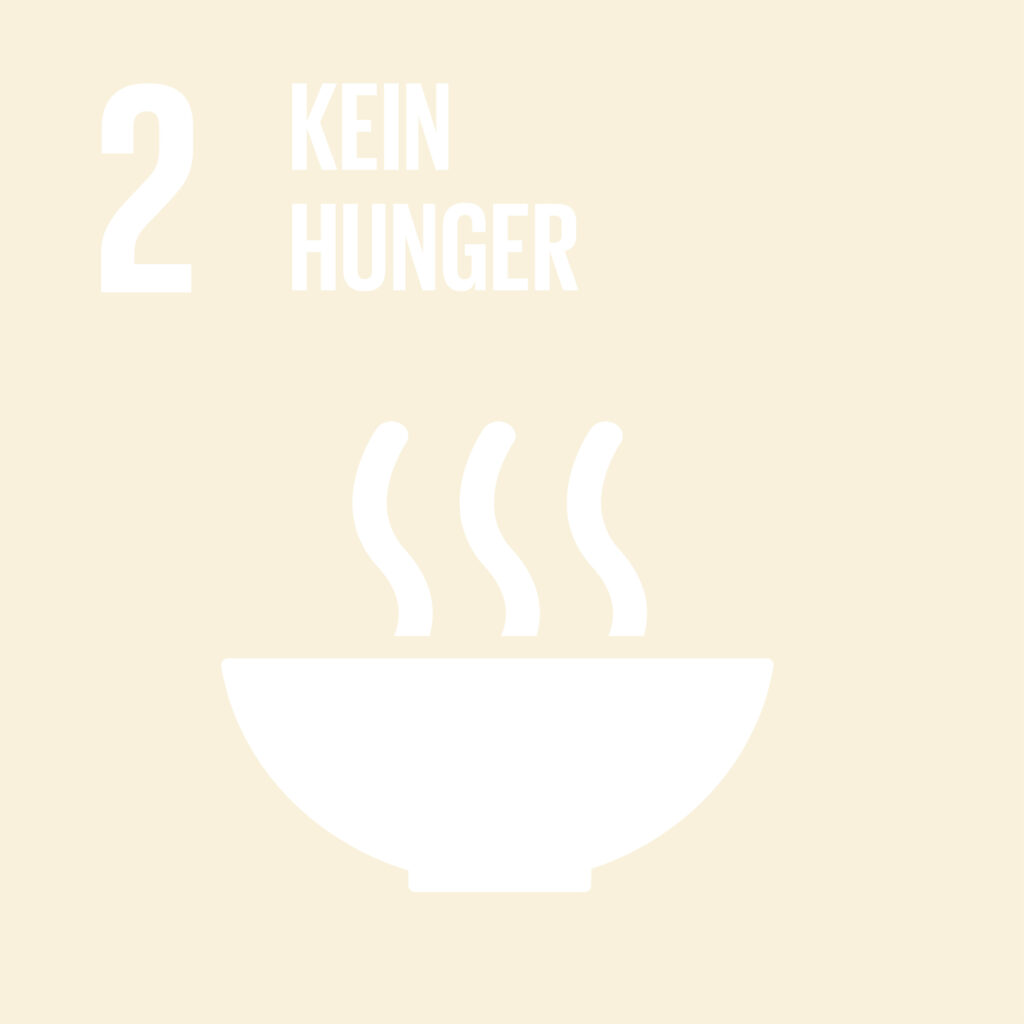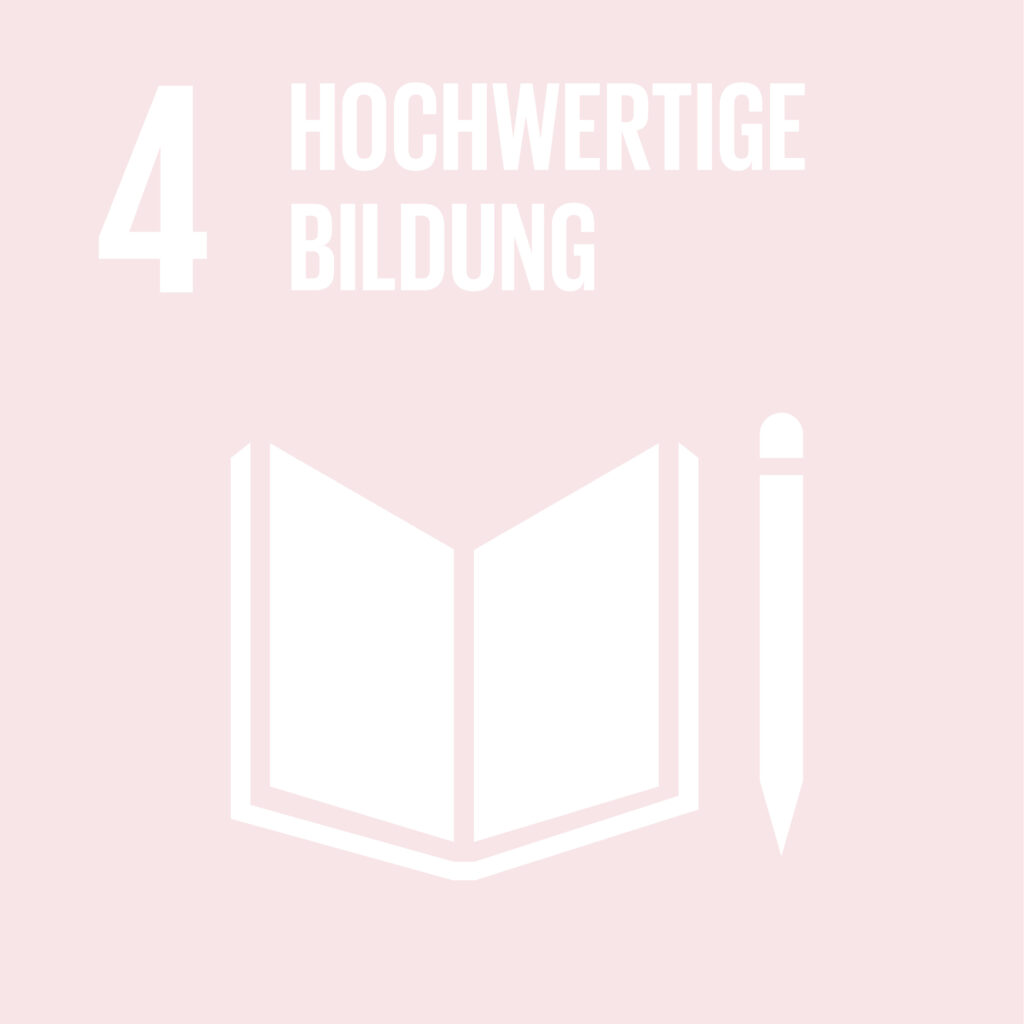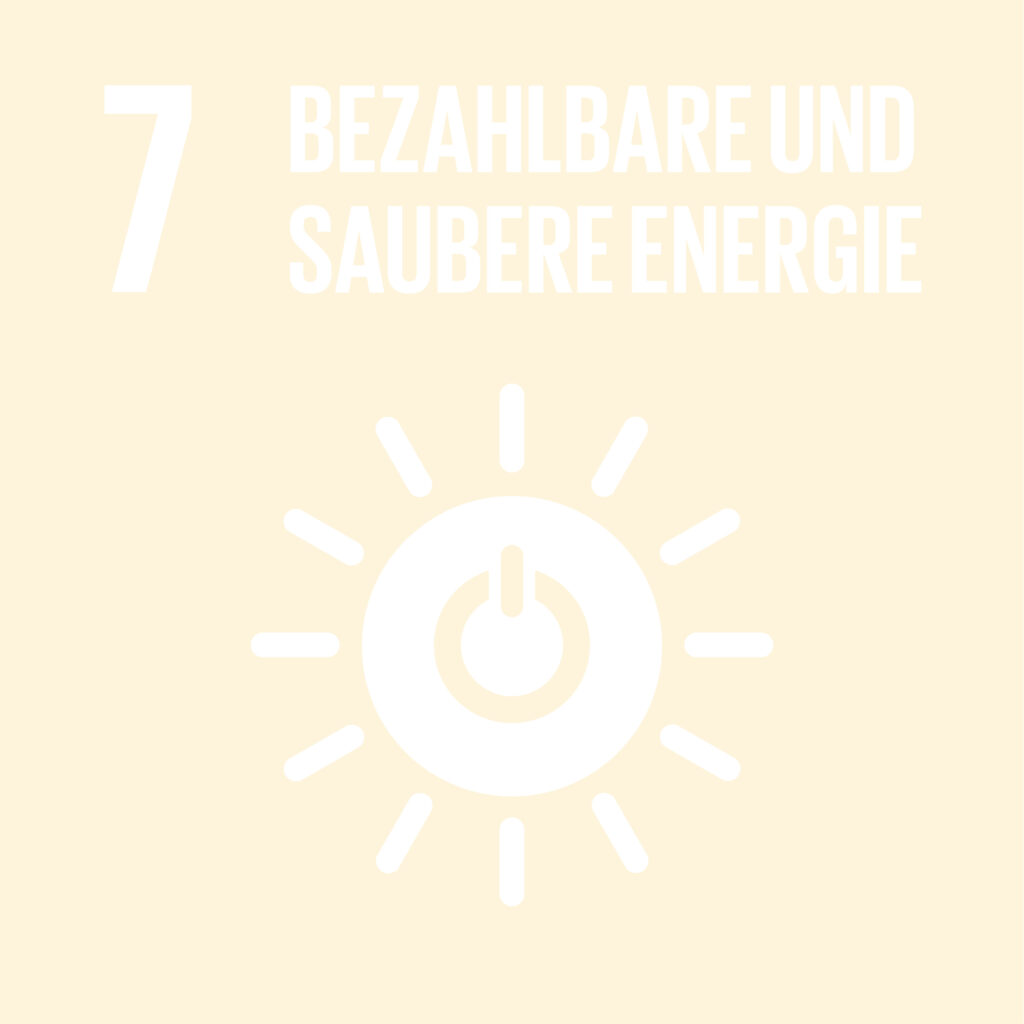Um es gleich vorweg zu nehmen: Wiesen sind ganz schön bunt! Bis zu 60 verschiedene Pflanzenarten kann man auf einem Quadratmeter Wiese finden. Allerdings findet man auf vielen Wiesen heute gerade mal noch an die 10, mit etwas Glück noch an die 20 Pflanzenarten. Entsprechend negativ wirkt sich das auch auf die Tierwelt aus.
Der Ort und das Projekt
Auf einem Wiesenstück am Mehrgenerationenplatz in Kucha, das der Gemeinde Offenhausen gehört, wollen wir versuchen, die Artenvielfalt lokal wieder zu erhöhen. Tipps dazu gibt u. a. das Bayr. Landsamt für Umwelt. Aktuell finden sich noch ca. 12 Blüharten vor Ort (siehe Wiesenanalyse unten), einige von ihnen wachsen nur vereinzelt. An die 15 bis 20 weitere Arten könnten hier aber noch wachsen. Pro Pflanzenart rechnet man mit 8 bis 10 vorkommenden Tierarten. Das zeigt, was jede Art mehr für eine Wiese bedeutet.
Der wichtigste Schritt: Weniger und nicht alles auf einmal mähen. So können Pflanzen Samen bilden und sich aussäen. Winterquartiere für alle möglichen Tiere und Futterstellen für Vögel bleiben erhalten. Kreisläufe schließen sich wieder.
Da viele Arten nicht mehr aus dem direkten Umfeld einwandern können, wollen wir außerdem auf einem Teil der Fläche bestimmte Pflanzen gezielt ansäen oder einsetzen. Einmal Verschwundenes wieder dauerhaft und stabil zurückzuholen, ist nicht so leicht wie man meinen möchte.
Es braucht auf jeden Fall Geduld und Zeit! Wir sind gespannt, ob es uns gelingen wird!

Mit wechselnden Aushängen wollen wir das Projekt durch´s Jahr begleiten und über den Prozess informieren. Um die Ausgangslage festzuhalten, hier eine kleine Analyse des Ist-Zustands:




Eine kleine Wiesenanalyse – Ist-Zustand:
Im oberen und linken Teil wächst eher dünneres Gras, in der unteren Schicht blüht es mehr, z. B. Sternmiere oder Hopfenklee. Im unteren Teil steht die Wiese etwas schattiger, durch die Hanglage ist es wohl auch feuchter. Dort dominiert das satter wachsende Knäulgras. Das Mädesüß zeigt eher nassen Boden an. Diese kleinen Unterschiede im Bewuchs schaffen wichtige Strukturenvielfalt (ein Aspekt der Biodiversität), die von den Tierarten wiederum ganz unterschiedlich bevorzugt und genutzt werden.
Was im Frühjahr auf der Fläche wächst, lässt sich jetzt im Sommer nicht mehr bestimmen. Mitte Juni waren folgende Arten auf der Wiese zu finden (ohne Gewähr auf Vollständigkeit):
Roter Wiesenklee
Wiesen-Glockenblume (eine!)
Wiesenlabkraut (flächig)
Wiesen-Platterbse
Zaun-Wicke (nur vereinzelt)
Spitzwegerich
Kleiner Sauerampfer
Sternmiere (nur vereinzelt)
Mädesüß
Hopfenklee
Wiesenpippau (nur vereinzelt)
Frauenmantel
und verschiedene Gräser, u. a. Knäulgras




Weitere 15 bis 20 Blüharten könnten auf der Fläche wachsen, zum Beispiel (Fotos siehe Links):
Kronwicke
Wiesen-Bocksbart
Hornklee
Wiesenkerbel
Kuckucks-Lichtnelke
Weiße Lichtnelke
Rotes Leimkraut/Lichtnelke
Vogel-Wicke
Wiesen-Schafgarbe
Wiesen-Flockenblume
Wiesen-Glockenblume
Knautia oder Wiesen-Witwenblume
Bach-Nelkenwurz
Artenschutz ist Klimaschutz
Pro Pflanzenart rechnet man mit etwa 8 bis 10 vorkommenden Tierarten. Das zeigt, was jede Art mehr für eine Wiese bedeutet. Wie man mittlerweile weiß, wirkt sich eine hohe Artenvielfalt auf der Wiese positiv auf den Boden aus. Sie führt zu stabileren und gesünderen Böden. Gesunde Böden wiederum speichern mehr CO2. Auch andere Ökosystemdienstleistungen verbessern sich. So können artenreiche Wiesen mit gesunden Böden mehr Wasser aufnehmen, was wiederum den Hochwasserschutz und die Trinkwasseraufbereitung verbessert. Artenschutz auf Wiesen ist also direkt auch Klimaschutz.

weitere Hintergrundinfos:
Ganz generell wächst etwa die Hälfte der ca. 4.000 heimischen Farn- und Blütenpflanzen auf Grünland, von all den Tieren, die hier leben, ganz zu schweigen. Wiesen sind bedeutende Lebensräume mit hoher Artenvielfalt. Obwohl sie ursprünglich durch die Aktivitäten des Menschen entstanden sind und sich über unsere ganze Kulturlandschaft ausbereitet haben, geht seit etwa 150 Jahren die Artenvielfalt auf Wiesen rapide zurück. Besonders stark ist der Rückgang seit den 1960er Jahren.
Die Gründe für das Verschwinden der Arten sind bekannt: Dünger- und Pestizideinsatz, und seit Jahrzehnten wird zu oft, großflächig und zu „ordentlich“ gemäht. Das Sauberkeitsideal in Kombination mit all den technischen Mäh-Möglichkeiten sind in unserer Landschaft zu einem starken Treiber für das Artensterben geworden.
So haben Wiesenpflanzen kaum mehr die Möglichkeit, ihre Samen reifen zu lassen und sich auszusäen. Die Folge: Über die Jahrzehnte hat sich der Samenpool im Boden so erschöpft, dass viele Arten nicht mehr nachwachsen und verschwinden. Einmal verschwunden, können sie sich auch dann nicht mehr einwandern, wenn sich an einzelnen Stellen die Bedingungen verbessern. Mit ihnen verschwinden auch die Tiere, die auf die Wiesenarten angewiesen sind. Das Ökosystem und der Mutterboden laugen aus, die Wiese kann ihre Ökosystemdienstelistungen wie CO2 speichern, Trinkwasser aufbereiten, Wasser aufnehmen – nicht mehr erfüllen.
Wir möchten einen wichtigen Austausch anstoßen, ins gemeinsame Tun kommen und die Umsetzung folgender SDGs im schönen Hammerbachtal unterstützen: