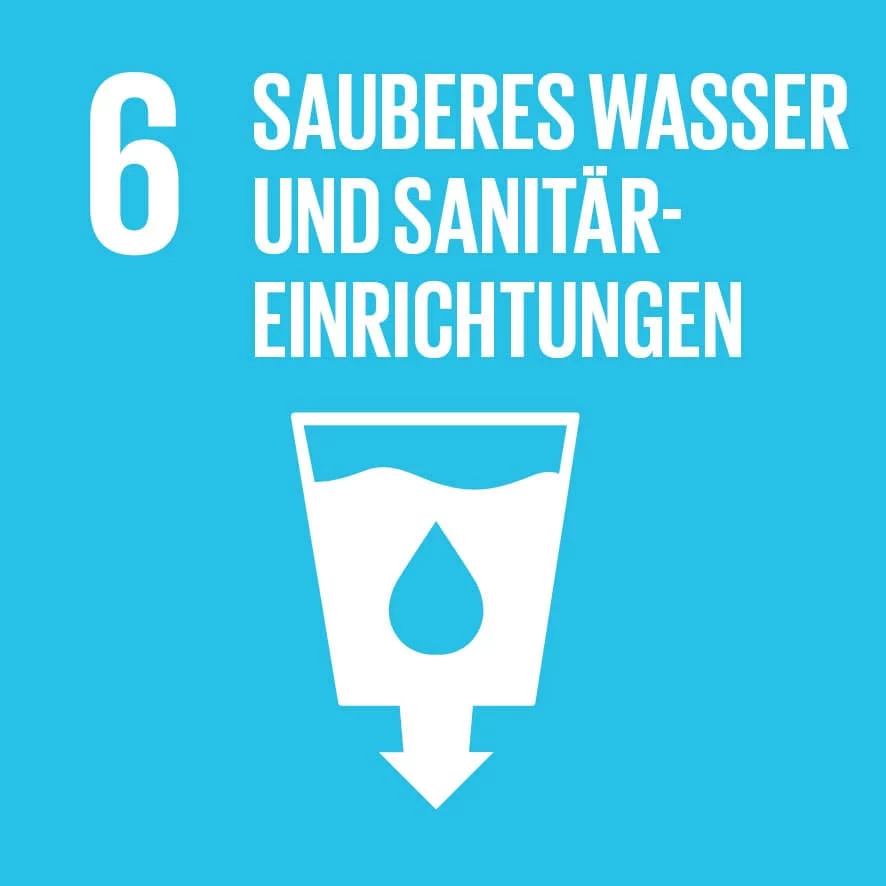Wasser! Wer genießt es nicht? Bei heißen Temperaturen ins kühle Nass springen; genüsslich ein Eis essen; die Füße in ein kaltes Wasserbad halten; ein eiskaltes Getränk zum Abkühlen trinken. Wasser ist Leben! Nicht nur Genuss, nein, Wasser ist Leben! Wir bestehen zu drei Vierteln daraus, es ernährt uns. Und es ist knapp, auch in Franken – weil wir Menschen zu stark in den Wasserkreislauf eingreifen, mit gravierenden Folgen.

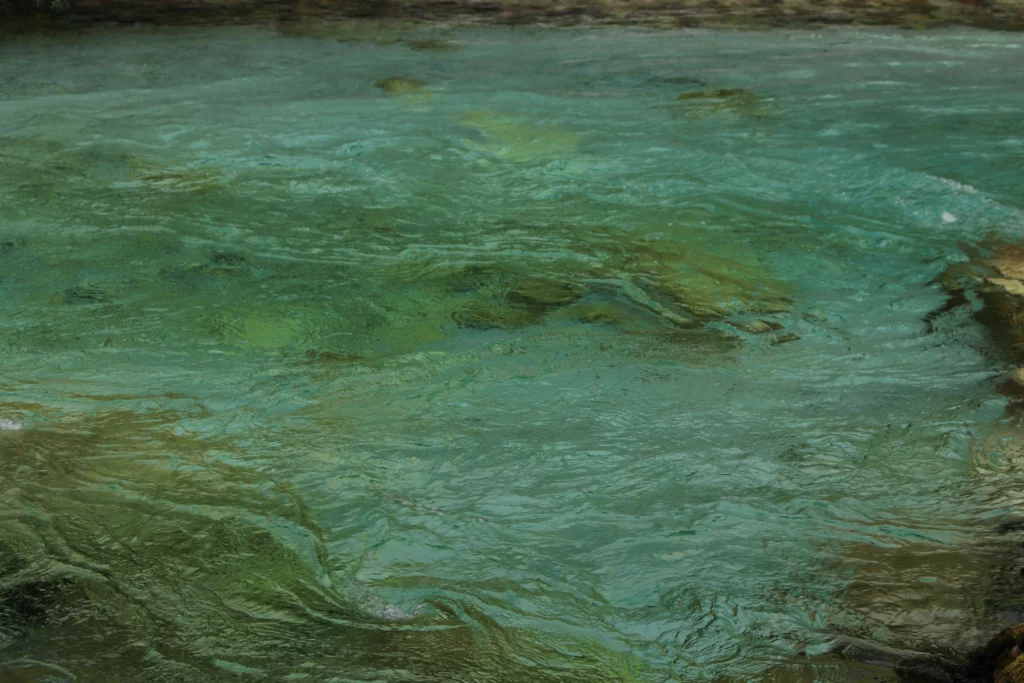

Die globale Dimension von Wasserknappheit
Die globale Perspektive lässt das Thema Wasserknappheit in einer ganz anderen Problemdimension erscheinen:
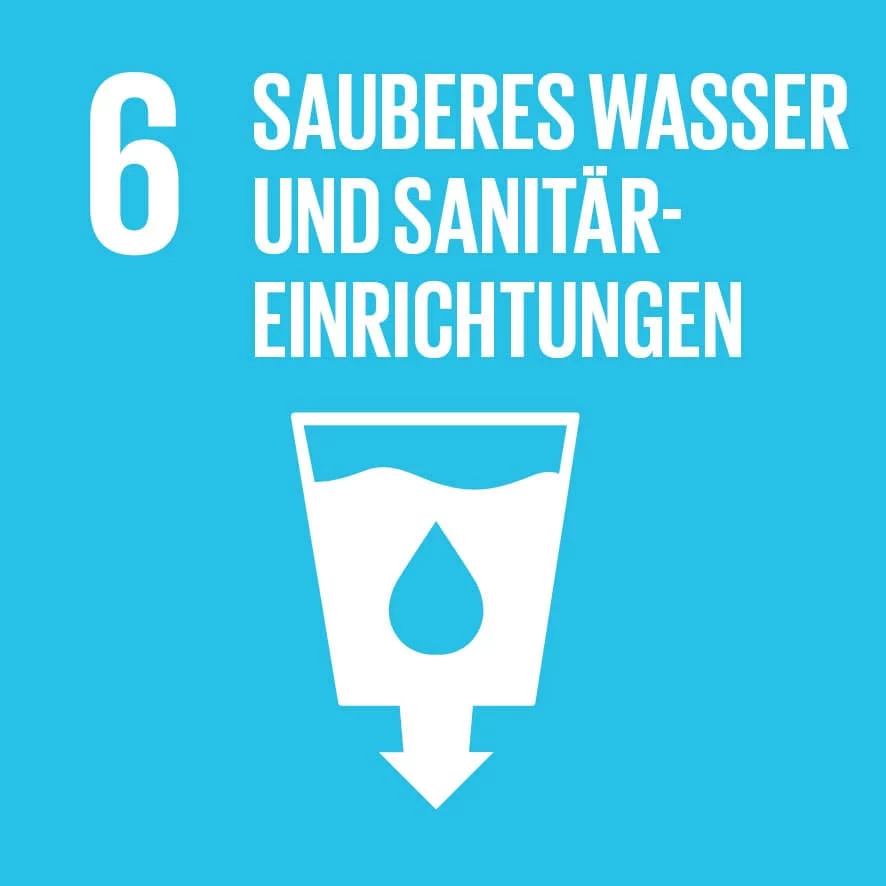
2,2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Verschmutztes Wasser trägt zur Ausbreitung von Krankheiten bei. Um Wasser anzuschaffen, können viele Kinder keine Schule besuchen. 700 Millionen Menschen könnten bis 2030 gezwungen sein, ihre Heimat zu verlassen, in der Folge von Wasserknappheit. Viele Menschen sind direkt von Dürre und als Folge von Hunger bedroht, durch ausbleibende Niederschläge und verunreinigte Seen und Flüsse. Von der Erhaltung von Ackerfläche, dem Erhalt der Artenvielfalt und vielem mehr, gar nicht erst anzufangen.
Darum hat das nachhaltige Entwicklungsziel, SDG 6, eine so überragende Bedeutung für die Menschheit. Mit SDG 6 wollen wir folgendes Ziel erreichen:
Die Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten.
17ziele.de
Konkreter sind die Unterziele beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung aufgelistet.
Wer sind die Leidtragenden in Franken?
Doch wie eingangs gesagt, gibt es nicht nur weit weg, sondern auch direkt hier bei uns in Franken Wasserknappheit. Die Wehrlosesten und Unsichtbarsten sind bei uns Tiere, Pflanzen, Pilze und Bakterien. Sie leiden unter Trockenheit und Hitze, verlieren ihre Widerstandsfähigkeit und sind anfälliger für Schädlinge, was eine Gefahr für die Artenvielfalt ist (mehr dazu hier). Gut sichtbar ist das im Wald: Der Borkenkäfer, Waldbrände und Stürme bedrohen ihn (Walderhebungsbericht). Bedenklich ist das, weil der Wald unser lokales Klima mitbestimmt, auf das wir unsere Landnutzung und somit auch unsere Ernährung angepasst haben, weil er Lebensraum für viele Arten ist, weil er Regen aufsammelt, in Grundwasser verwandelt und den Klimawandel bekämpft, indem er CO2 speichert.
Wer direkter für sein Leid sprechen kann, sind die Landwirt*innen. Viele Kulturen lassen sich in Franken aufgrund der Klimakrise ohne Bewässerung nicht mehr anbauen. Das verbraucht viel Wasser – meistens Grundwasser. Und ist, nebenbei bemerkt, teuer. Und wer wundert sich über die hohen regionalen Gemüsepreise?
Das Dilemma ist: Die Landwirt*innen sind nicht die einzigen, die auf das knapper werdende Grundwasser Anspruch erheben. Unsere Trinkwasserversorgung hängt am Tropf des Grundwassers. Es mehren sich also schon die Vorkommen von Konflikten um die Wasserverteilung – in Franken.
Ist die Entnahme von Wasser aus Seen und Flüssen eine Alternative?
Wer über den Tellerrand in andere Regionen schaut, merkt, dass die Entnahme von sogenanntem Oberflächenwasser das Problem eher verschärft. Vielerorts trocknen Flüsse und Seen aus, weil ihnen mehr Wasser entnommen wird als sich nachbilden kann. Die Folgen für die lokal angepassten Ökosysteme, und somit die Artenvielfalt, sind dramatisch. Außerdem fußt in vielen Ländern die Wasserversorgung auf Oberflächengewässern. Sie ist durch die Austrocknung unmittelbar gefährdet. Beispiele für die menschlich verursachte Austrocknung sind der Aralsee in Zentralasien, der Colorado River in den USA, aber auch See und Flüsse in Frankreich und Italien, und sogar der ostdeutsche Fluss “Schwarze Elster” – sie alle trocknen aus, oder sind davon bedroht, wenn kein Wandel passiert.



Wie weit soll es kommen?
Das Land Hessen steht vor ähnlichen Problemen wie wir Franken. Lokal gelten dort seit kurzem klare Regeln: Keine Trinkwasserentnahme mehr für Grünflächenbewässerung über 200 qm in Königstein (Hochtaunus). Und gar keine Gartenbewässerung oder Brunnenentnahmen in Grävenwiesbach (Hochtaunus), wo der Trinkwassernotstand sogar schon ausgerufen wurde (hessenschau.de, 18.06.2022). Wollen wir es soweit kommen lassen?
Die andere Seite der Medaille: Zu viel des Guten.
Das genaue Gegenteil von Wasserknappheit hat sich 2021 im Ahrtal abgespielt, mit katastrophalen Folgen für die lokale Bevölkerung und die Natur. Starkregen, und das ohne Unterlass, mündete in einer Flutkatastrophe. Es gibt viele Beispiele von Siedlungsüberflutungen in Deutschland in den letzten Jahren. Und es werden nicht weniger. Genauer betrachtet gibt es bei uns immer menschengemachte Voraussetzungen dafür, dass der Regen nicht ausreichend abfließen kann.
Ein Exkurs zu den Gründen: Der Eingriff in Versickerungsflächen
Neu sind die Probleme nicht mehr. Schon vor der Jahrtausendwende haben sich Bayern und Baden-Württemberg mit dem Deutschen Wetterdienst zusammengeschlossen, um zum Thema „Klimaveränderung und Konsequenzen für die Wasserwirtschaft“ (KLIWA) längerfristig zusammenzuarbeiten. Der in Nürnberg 2016 herausgegebene Bericht “Zukunftsweisender und nachhaltiger Umgang mit Regenwasser”, nennt die Treiber beim Namen.



Tritt im Zuge der Klimakrise vermehrt Starkregen auf, sind die Wassermassen davon abzuhalten, die Kanalisation zu überfluten und Schäden zu verursachen. Die fortschreitende Flächenversiegelung durch die Siedlungsentwicklung im Stadtgebiet erhöht den Druck. Sicker- und Auffangflächen braucht es! Sonst bildet sich auch kein Grundwasser neu. Der Bericht nennt Lösungsansätze für das Problem: Begrünte Dächer, Straßenbegleitgrün, Flächenentsiegelung, und Regenwassernutzung (durch Zisternen) für die Gartenbewässerung, die Toilettenspülung und das Wäschewaschen etc..
Was tut Nürnberg?
Und tatsächlich ist “Schwammstadt” ein geflügeltes Wort, seit die Starkregenfrequenz zunimmt. Die Stadt Nürnberg verfolgt sogar einen Masterplan Freiraum, der Nürnberg grüner und zukunftsfähiger machen soll – die Umsetzung passiert leider zu langsam. In Stadtentwicklungsgebieten fördert sie private Begrünungs- und Entsieglungsmaßnahmen, unter dem Namen Mehr Grün für Nürnberg. Schranken für die Umgestaltung setzt die aktuelle Mobilitätspolitik, die eine Abnahme der Autoanzahl, der Parkplätze und Straßen und somit mehr Platz für Entsiegelung und Umgestaltung zu grünen Parks verhindert.
Ohne Mobilitätswende geht´s eben nicht
Wer damit unzufrieden ist, sollte sich z. B. dem Bündnis für die sozialgerechte Mobilitätswende anschließen, unermüdlich bei Beteiligungsverfahren zu Umgestaltungsprojekten der Stadt mitmachen, entsprechende Anträge für Entsiegelung im Stadtrat unterstützen, Lobbyarbeit machen, Mobilitätsprojekte wie Lastenrad für alle unterstützen und, und, und…

Entsiegelung live zum Anschauen gibt es beim Projekt Weltacker, von SDGs go local und der Stiftung Innovation und Zukunft – ein Beispiel für Entsiegelung auf einer städtischen Fläche, umgesetzt durch die Projektakteure. Mehr zur Entstehung und allen aktuellen Meldungen ist hier beschrieben.
Ein Beitrag – Regenwasser zur Gartenbewässerung

Um zur Entlastung des Grundwassers beizutragen, sind seit kurzem Regensammler im Einsatz, die zwei Kooperationsprojekte von SDGs go local mit der Essbaren Stadt mit Regenwasser versorgen Vischers Hochbeete und den Lindengarten.

Noch ist die Stadt nicht soweit mit ihren Genehmigungen, aber wir wünschen uns auch am Bielingplatz und bei einigen anderen Essbare Stadt Standorten eine Regenauffangplane, die das Regenwasser in die Gießtanks leitet.
Außerdem haben wir zusammen mit dem GartenNetzwerk Nürnberg (GNN) die Initiative #1000TanksfürNürnberg ins Leben gerufen. Mehr Infos dazu und wie du mitmachen kannst, erfährst du hier.
Was kannst du noch tun?
Wer kein Zisterne in den Garten bauen und keine Regentonne aufstellen kann, der kann trotzdem viel dafür tun, dass weniger Wasser verbraucht wird, und zwar durch seinen direkten und seinen virtuellen Wasserverbrauch. Den direkten Verbrauch kann man hier berechnen. Der virtuelle Wasserverbrauch ist wie der ökologische Fußabdruck für Wasser, statt für CO2. Wer ihn senken will, kann sich saisonal, regional und fleischarm ernähren, wenig wegwerfen, und wenig, aber langlebiges konsumieren.
Mit unserem Einsatz für die Nutzung von Regenwasser wollen wir eine Auseinandersetzung mit dem Thema Wasser und dem bewusster Konsum rund um Wasser anstoßen und einen Beitrag zur Umsetzung folgender SDGs leisten: